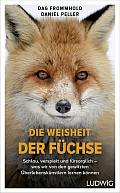FAQ: Tollwut
3.1 Füchse und Wildtierkrankheiten
3.1.1 Was ist die Tollwut?
Die Tollwut ist eine ansteckende, ohne sofortige Behandlung tödlich verlaufende Viruskrankheit, die durch Speichel
oder Blut (in der Regel den Biß eines infizierten Tieres) übertragen wird. Als Symptome werden beim Menschen Bewusstseinsstörungen,
Lähmungen, Atemkrämpfe, Wasserscheu, oft Wutanfälle beschrieben. Die Inkubationszeit beträgt 20 bis 60 Tage. Heute gibt es
wirksame Impfungen gegen die Tollwut, und innerhalb eines Tages nach dem Biss eines tollwütigen Tieres ist auch eine
sogenannte postexpositionelle Impfung noch möglich, die das Überleben sichert. Dadurch hat die Tollwut zumindest in Europa
ihren Schrecken weitestgehend verloren.
Füchse spielten im Infektionsgeschehen der europäischen Nachkriegszeit eine zentrale Rolle. Sie sind nämlich – wie
andere Hundeartige auch – für das Tollwutvirus besonders anfällig und können bereits an einem Zehntausendstel der
Virendosis erkranken, die nötig ist, um einen Menschen zu infizieren. So kam es, dass die Tollwut bald ungezügelt
in der Fuchspopulation grassierte. Punktuell übertrugen erkrankte Füchse sie durch Bisse auf Haustiere, und diese
gaben das Virus dann vereinzelt an Menschen weiter. Allerdings gab es in Deutschland zwischen 1947 und 1981
gerade einmal neun Infektionsfälle bei Menschen.
Heutzutage ist Mitteleuropa vollständig frei von der sogenannten terrestrischen Tollwut, jener Tollwutform, die beim Fuchs
und anderen Beutegreifern auftreten kann. Lediglich die Fledermaustollwut, die jedoch von einem anderen Virustyp verursacht wird
als die terrestrische Tollwut und mit ihr epidemiologisch nicht in Verbindung steht, kommt bei uns noch immer vor.
3.1.2 Wie groß ist die Gefahr, an Tollwut zu erkranken?
Heutzutage ist die terrestrische Tollwut in Mitteleuropa ausgerottet. Die Internationale Gesellschaft für Tiergesundheit (OIF)
erklärte Finnland und die Niederlande bereits 1991 für tollwutfrei; 1997 folgte Italien, 1998 die Schweiz, 2000 Frankreich,
und im Jahr 2008 schließlich Deutschland und Österreich. Insofern besteht bei uns heutzutage überhaupt kein
Erkrankungsrisiko mehr.
Selbst in den 1980er Jahren, als die Tollwut in Deutschland noch großflächig grassierte, wurde die
Wahrscheinlichkeit für einen Menschen, an Tollwut zu erkranken, mit eins zu 171.875.000 beziffert - das Risiko,
vom Blitz getroffen zu werden, war zwanzigmal höher.
3.1.3 Welche Rolle spielt die Tollwut heute?
Die Tollwut ist in Mittel- und Westeuropa heute bedeutungslos. Umso unverständlicher ist, dass sie bisweilen noch immer
zur Begründung für die Jagd auf Füchse angeführt wird. Auch die in den 1980er- und 1990er-Jahren allgegenwärtigen Schilder
"Tollwut - gefährdeter Bezirk" sind noch immer nicht von allen Ortseingängen verschwunden.
3.1.4 Woran erkennt man ein an Tollwut erkranktes Tier?
Tollwutkranke Wildtiere zeigen oft keinerlei Scheu mehr vor dem Menschen. In späteren Stadien der Krankheit zeigen befallene Tiere
oft starke Wahrnehmungstrübungen und bisweilen Anzeichen von Apathie und zunehmender Schwächung, die bei Annäherung
von Menschen oder anderen Tieren jedoch durch kurze aggressive Ausbrüche unterbrochen werden kann. Zudem geht die
Tollwut - wie andere Wildkrankheiten auch - mit einem deutlich angegriffenen, ausgemergelten Aussehen des betroffenen
Tieres, stumpfem, struppigem und ausgedünntem Fell einher.
Da die Tollwut bei uns ausgerottet ist, können Sie allerdings mit Sicherheit davon ausgehen, dass Sie bei uns keinem tollwütigen
Wildtier begegnen werden. Wenn ein Fuchs zutraulich ist, hat das übrigens nur äußerst selten etwas mit einer Erkrankung zu tun.
Insbesondere in städtischen oder stadtnahen Regionen leben Füchse oftmals in so unmittelbarer Nähe zu Menschen, dass sich ihre
Scheu nach und nach verringert. Werden sie dann noch von wohlmeinenden Bürgern gefüttert, können die betreffenden Füchse - je
nach individueller Disposition - durchaus regelrecht frech werden und lassen sich bisweilen auch durch lautes Rufen nicht
sofort vertreiben.
3.1.5 Wie wurde die Tollwut bekämpft?
Insbesondere in den 1960er- bis 1980er-Jahren versuchte man die Tollwut vornehmlich durch die Tötung von Füchsen zu bekämpfen.
Die Grundidee war damals, Füchse so stark zu dezimieren, dass Begegnungen zwischen ihnen selten werden – so selten, dass ein
infizierter Fuchs vor seinem Tod im Durchschnitt weniger als einen anderen Fuchs anstecken kann. Berechnungen zufolge war es
dafür notwendig, den Fuchsbestand auf nur 0,3 Füchse pro Quadratkilometer zu reduzieren. Bereits 1959 wurden daher Abschussprämien
für Füchse gezahlt. Ab 1964 begann man zusätzlich in vielen Bundesländern, die Bewohner jedes bekannten Fuchsbaus mit dem berüchtigten
Giftgas Zyklon B zu töten.
Wie wir heute wissen, endeten diese Versuche, die Tollwut zu bekämpfen, in einem Fiasko (siehe
5.3.2, Ist Fuchsjagd dazu geeignet, Wildtierkrankheiten wie die Tollwut einzudämmen?). Dass die Tollwut in Europa dennoch
besiegt werden konnte, ist vielmehr der Veterinärmedizin zu verdanken. 1978 wurden in der Schweiz im Rahmen eines Feldversuchs
erstmals Köder mit Tollwutimpfstoff eingesetzt, und ab 1983 fanden dann auch in Deutschland Feldversuche mit einer Schluckimpfung
für Füchse statt. Ihren Siegeszug trat die Tollwutimpfung schließlich an, als man begann, Impfköder aus Fischmehl, Paraffin und
pflanzlichen Fetten industriell zu produzieren und im großen Stil automatisiert aus Flugzeugen abzuwerfen.
Die Kosten für die Impfkampagnen beliefen sich dabei auf nur auf ein Dreizehntel der Aufwendungen, die zuvor für die kontraproduktiven
Baubegasungen und Tötungsprämien angefallen waren.
Literatur:
Debbie, J. (1991): Rabies control of terrestrial wildlife by population reduction. In: Baer, G.M. (Ed.), The natural History of Rabies. CRC Press, Boca Raton.
Schneider, L.G. (1991): Einfluss der oralen Immunisierung auf die Epidemiologie der Tollwut. Fuchs-Symposium Koblenz. Schriften des Arbeitskreises Wildbiologie an der Justus-Liebig-Univ. Gießen, 20.
Debbie, J. (1991): Rabies control of terrestrial wildlife by population reduction. In: Baer, G.M. (Ed.), The natural History of Rabies. CRC Press, Boca Raton.
Schneider, L.G. (1991): Einfluss der oralen Immunisierung auf die Epidemiologie der Tollwut. Fuchs-Symposium Koblenz. Schriften des Arbeitskreises Wildbiologie an der Justus-Liebig-Univ. Gießen, 20.
3.1.6 Wie kann ich mich vor Tollwut schützen?
Ein besonderer Schutz ist in Europa nicht erforderlich. Lediglich für bestimmte Risikogruppen wie Tierärzte, die mit potentiell
tollwutkranken Tieren (z.B. im Ausland) zu tun haben, bietet sich eine Schutzimpfung an.